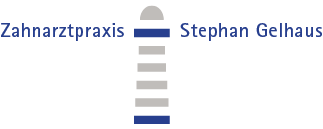Ein Leuchtturm als Symbol für eine Zahnarztpraxis ist ungewöhnlich, fnden Sie? Sie haben recht. Es ist ein ungewöhnliches Symbol. Aber gerade deswegen ist es auch genau das richtige Symbol für uns, weil wir eine ungewöhnliche Zahnarztpraxis sind.
Wie die Geschichte des Leuchtturms begann, ist nicht bekannt. Man kann aber annehmen, dass die Menschen bald nach den ersten Seefahrten damit angefangen haben, am Ufer leuchtende Zeichen zu setzen, die bei einer sicheren Rückkehr der Boote vom Meer halfen. Im Laufe der Menschheitsgeschichte sind daraus Leuchttürme geworden. Bedeutende Leuchttürme und Weltwunder wie der Pharos von Alexandria oder der Koloss von Rhodos aber auch ganz einfache unzählige Türme, die die Küsten auf der ganzen Welt säumen.
Egal, ob groß und bedeutend oder klein, alle Leuchttürme überall auf der Welt dienten und dienen einem einzigen Zweck: den Weg in den Hafen zu weisen. In den Ort, an dem man sicher ist. Sicher vor Gefahren und Krankheit.
Vielleicht denken Sie jetzt, dass der Leuchtturm als Symbol für eine Zahnarztpraxis doch gar nicht so ungewöhnlich ist? Warten Sie es ab. Besuchen Sie uns und lernen Sie uns kennen. Ungewöhnlich sind wir auf jeden Fall.
Eine (nicht ganz so kurze) Geschichte über die Entstehung des Leuchtturms oder…
»Wie das Licht auf die Leuchttürme kam.«
Vermutlich waren es Frauen. Niemand weiss, wann sie zum ersten Mal auf den Gedanken kamen. Sie gingen nachts hinaus ans Meer und entfachten auf einem Hügel oder einer Klippe ein Feuer. Sein flackernder Schein sollten die heimkehrenden Boote in die sichere Bucht leiten. Es waren Frauen, die auf ihre Männer warteten. Es waren Mütter, die um ihre Söhne bangten. Sie stapelten Scheit auf Scheit und bemühten sich, die Flammen vor dem Wind zu schützen. Dann starrten sie auf die See und hofften, in der Finsternis endlich die ersehnten Boote zu erkennen – bis der Morgen graute und das Feuer erlosch. Die Boote waren nicht heimgekehrt. So brannte in der nächsten Nacht wahrscheinlich wieder ein Holzstoss, ein einziges verlorenes Licht an der dunklen Küste. So hat es vielleicht angefangen.
Erst ab 800 v. Chr. gingen an den Küsten allmählich mehr Lichter an. Die Griechen errichteten rund um die Ägäis die ersten offiziellen Feuerstellen: im Hafen von Athen, in der Einfahrt zum Hellespont, am Bosporus. Auch am Schwarzen Meer flackerten die ersten Lichter auf. Damals brannten die Feuer meist noch auf Steintrümmern. Im dritten Jahrhundert v. Chr. zeigte sich dann, wie hoch der Stellenwert der Leuchtfeuer bereits war. Ptolemaios II. von Ägypten liess auf der Felseninsel Pharos vor Alexandria einen Leuchtturm bauen, der die Welt in Erstaunen versetzte. 17 Jahre lang schufteten Sklaven sich halb zu Tode, bis das Bauwerk stand. Es wurde mehr als 100 Meter hoch. Rund anderthalb Jahrtausende half der Turm den Seefahrern, sich zu orientieren, bis er im 14. Jahrhundert durch Erdbeben zerstört wurde. 1995 fanden Taucher im Hafen von Alexandria die Reste dieses Turms, der zu den sieben Weltwundern zählt. Als Urvater gab er durch seinen Standort den Leuchttürmen in vielen romanischen Sprachen ihren Namen, so z. B. »phare« im Französischen oder »farol« im Portugiesischen.
Dann kam Rom. Eine solch grosse Macht hatte natürlich Interesse daran, den Kapitänen ihrer Kriegs- und Handelsschiffen, den Weg zu den Kolonien zu leuchten. An den Küsten wurde es noch heller. Aus dieser Zeit stammt der Herkules-Turm in Spanien, der vermutlich im zweiten Jhd. n. Chr. erbaut wurde (siehe unter »Ältester Leuchtturm«). Doch dann, um 500 n. Chr. wurde es wieder dunkel. Rom hatte seine Macht, die Küsten somit ihren Schutz verloren. Sie waren nun hilflos plündernden und mordenden Seeräubern ausgeliefert. Also löschten die Menschen ihre Feuer, um den Feind nicht auch noch anzulocken. Den Neuanfang wagten etwa ab dem 12. Jhd. einige Mönche, die den Seeleuten helfen wollten. Doch die Angst vor den nächtlichen Überfällen sass so tief, dass es noch lange Zeit dauerte, bis es entlang der Ufer tatsächlich wieder heller wurde. Als die ersten Küstenbewohner jedoch dahinter kamen, dass man mit Leuchtfeuern gutes Geld verdienen konnte, flackerten immer mehr Lichter auf.
Besitzer von Grundstücken an der Küste bauten mit Erlaubnis der Obrigkeit Türme und verlangten von den passierenden Schiffen, kaum dass sie im nächsten Hafen festgemacht hatten eine Art Wegezoll. Weigerte sich ein Kapitän zu zahlen, drohte im Arrest. Notfalls wurden die Papiere konfisziert und das Schiff am Auslaufen gehindert. Den Wegezoll zahlten die Kapitäne aber meistens gern, denn es hätte noch schlimmer kommen können. Nicht jede Feuer-stelle wurde nämlich aus Menschenfreundlichkeit errichtet. Ganze Dörfer lebten davon, Schiffe mit falschen Feuern in seichte Gewässer oder auf Felsen zu locken. Die Bewohner warteten dann am Strand mit Äxten und Eisenstangen nur darauf, den Schiffsbrüchigen die Schädel zu zertrümmern. So konnten sie die Schiffe plündern, ohne lästige Zeugen fürchten zu müssen. Wann jemand auf die Idee kam, für die Leuchtfeuer Kohle statt Holz zu benutzen, ist nicht bekannt. Fest steht, dass ab dem 17. Jhd. Steinkohlefeuer auf den Leuchttürmen üblich waren; sie leuchteten immerhin schon etwa zehn Kilometer weit. Aber noch hatte man keine Vorrichtung erfunden, um das Feuer vor Regen und Wind zu schützen. Und bei Sturm, wenn es am dringendsten gebraucht wurde, war es äusserst schwierig, das Feuer am Brennen zu halten. Zwar kannte man schon Öllampen, aber für Leuchttürme waren sie ungeeignet, da ihre Reichweite nur gering war.
Das änderte sich erst, als der Schweizer Aime Argand 1784 eine neue Lampe entwickelte – mit einem hohlen Docht. Die durch ihn strömende Luft sowie die Aussenluft verbesserten die Verbrennung des Öls erheblich. Diese Lampen wurden mit einem Hohlspiegel kombiniert, sodass 20 % des Lichts dorhin gelenkt wurden, wo man es tatsächlich benötigte. Bei normalen Sichtverhältnissen konnte ein Kapitän so das Leuchten schon aus 30 km Entfernung erkennen. Einige Jahre später wurden dann im Leuchtturm von Cordouan im Südwesten Frankreichs erstmals solche Lampen angebracht. Man montierte sie kreisförmig auf einer rotierenden Scheibe – es entstand ein Blinkfeuer. Diese Blinkfeuer wurden notwendig, weil die Zahl der Leuchttürme stetig anstieg. Das machst sie allmählich zum Sicherheitsrisiko, weil kein Mensch mehr den einen vom anderen unterscheiden konnte. Zudem wurden die Aufgaben die Lichter vielfältiger.
In England kam man bereits 1540 auf die Idee, zwei Türme hintereinander zu bauen. Um in der Fahrrinne zu bleiben musste der Kapitän nur beide Lichter wie Klimme Korn übereinander bringen – das erste Richtfeuer war erfunden. Damit man die Leuchttürme leichter auseinander halten konnte, gab man ihnen zusätzlich so genannte Kennung, die in den Seekarten vermerkt wurden: Lichtsignale, z. B. Blitze mit unterschiedlicher Länge und Häufigkeit. Die Argandsche Lampe blieb fast das ganze 19. Jhd. hindurch die Standardlichtquelle. Teilweise wurden gleich sechs der luftgespeisen Dochte ineinander gesteckt; einige dieser Lampen schluckten in einer Stunde ein Kilogramm Petroleum, und der Wärter musste im Laufe eines Jahres 50 m Docht nachschieben.
Den nächsten Fortschritt brachte schliesslich die Gaslampe. 1880 nahm im Hafen des damals deutschen Pillau, heute das russische Baltijsk an der Danziger Bucht – ein unbemannter und gasbetriebener Leuchtturm den Betrieb auf. Inzwischen hatte man nämlich herausgefunden, wie man Gas komprimieren oder verflüssigen kann. Dadurch konnte eine Leuchtturmlampe jetzt monatelang brennen, ohne dass jemand sie ständig mit Nachschub versorgen musste.
1885 erfand der Österreicher Carl Auer von Welsbach einen chemisch präparierten Glühstrumpf aus Seide, dessen Flamme durch ein Gas Gemisch genährt wurde. Diese Erfindung wurde sehr bald für Leuchttürme verwendet. Schon früher hatte man erkannt, dass man den relativ schwachen Schein einer Flamme verstärken kann, z. B. mit Hohlspiegeln. Nun kam eine weitere Verbesserung hinzu. Es war der französiche Physiker Augustin Jean Fresnel, dem 1823 schliesslich ein Licht aufging; seine bizarr aussehende Gürtellinse umhüllte die Lampe. Sie vermochte die Strahlen extrem stark zu bündeln und in eine konkrete Richtung zu werfen. Plötzlich betrug die Lichtausbeute nicht mehr 20, sondern 80 %. Diese Linsen finden bis heute Verwendung. So hat das Lizard Lighthouse im südenglichen Cornwall nur eine 400-Watt-Birne, die Fresnel-Linse feuert das Licht aber 40 km aufs Meer hinaus.
Die Elektrizität setzte sich erst ab 1920 durch – mit der Glühbirne. Später gab es dann noch lichtstärkere Birnen, z. B. moderne Metallhalogen Lampen, die so hell sind, dass sie zur Verstärkung keine Fresnel-Linse mehr benötigen, sondern mit einem einfachen Parabolspiegel auskommen. Die ständig verbesserte Technik verdrängte immer mehr den Menschen. 1925 begann man in Deutschland damit, Leuchtfeuer kleiner Türme zu automatisieren. Ab 1950 funktionierten dann auch die grossen Türme automatisch. Besatzungen wurden nicht mehr gebraucht. Der letzte deutsche Leuchtturmwärter verliess 1998 den Turm »Dornbusch« auf der Ostsee Insel Hiddensee. Nun werden die 52 Leuchttürme in der Nord- und Ostsee von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. Die Köpfe der Türme werden elektronisch gesteuert und regelmässig von Wartungstrupps kontrolliert. Sensoren messen meteorologische Daten und den Wasserstand. Zeitschaltuhren knipsen das Licht an, wenn es dämmert. Ein Videograf, der ähnlich wie ein Radargerät funktioniert, misst die Feuchtigkeitswerte in der Luft und schaltet bei Bedarf automatisch das Nebelhorn an. Wenn ein Leuchtturmlicht nicht mehr funktioniert, wird in den Verkehrszentralen, die den Schiffverkehr überwachen, Alarm ausgelöst.
Werden die Leuchttürme bald ganz überflüssig? Wohl nicht, denn selbst die modernste Ausrüstung kann nicht über den Verlauf einer Fahrrinne informieren. Das tun so genannte Leuchttonnen, die den »Strassenrand« markieren. Wenn sie im Winter vom Eis verschoben werden, hilft nur ein festes Licht. Hinzu kommen technische Einrichtungen wie die Funkfeuer, akustische Signale, die ein Turm funkt und die ebenfalls bestimmte Kennung haben. Radaranlagen auf einigen Leuchtturmdächern schicken ihre Daten zu Radarlotsen in den Verkehrszentralen, die sich auf diese Weise ein Bild vom Schiffsverkehr machen und bei Bedarf eingreifen können.
Man mag nun den Verlust der ›Leuchtturm-Romantik‹ beklagen, aber wenn damit ein Mehr an Sicherheit verbunden ist, dann ist das wohl in Ordnung. Und auch Seeleute werden damit einverstanden sein. Denn für sie gilt von jeher: »Safety first!«
Meeresgong von Henning Albers & Lutz Berger Der Klang des Unendlichen.